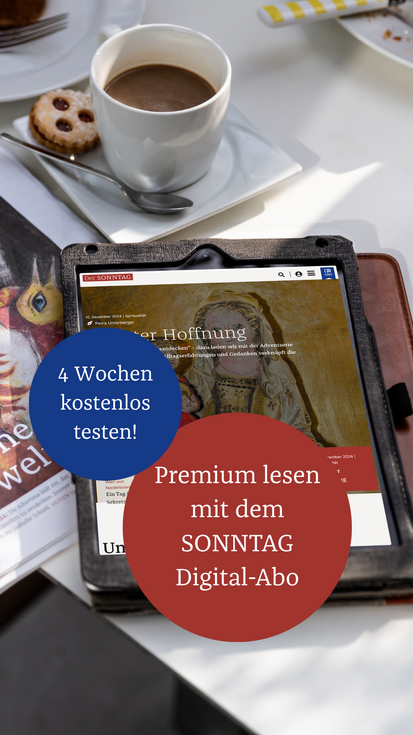Kirche und Judentum
Dialog der GeschwisterGepriesen sei der Gott Israels. Ökumenische Erkundungen in Liturgie, Verkündigung und Glaubensvermittlung im Angesicht des Judentums“: So lautet der Titel des 47. Symposions der Liturgischen Kommission Österreichs (einer Kommission der Österreichischen Bischofskonferenz) vom 29. bis zum 30. September im Salzburger Bildungszentrum Sankt Virgil. „Für das Christsein ist die Auseinandersetzung mit dem Judentum heute unerlässlich“, unterstreicht Professor Christian Rutishauser im Gespräch mit dem SONNTAG. Der Jesuit, er lehrt an der Universität Luzern, spricht am 29. September in Salzburg über den „Dialog mit dem Judentum: kirchliche, liturgische und spirituelle Auswirkungen“.
Ist die christlich-jüdische Begegnung mehr als nur eine Sache der „Fachleute“, erreicht sie auch die „Basis“ in der Kirche?
CHRISTIAN RUTISHAUSER: Für das Christsein ist die Auseinandersetzung mit dem Judentum heute unerlässlich. In jedem Evangelium, in jedem Gottesdienst begegnen wir Juden, nicht nur den Pharisäern und Gegnern Jesu. Jesus kommt aus einer jüdischen Familie; Maria war eine jüdische Mutter, Mirjam; alle Jünger und auch Paulus sind Juden. Die neutestamentlichen Schriften sind jüdisch-messianische Texte ihrer Zeit. Christlich werden sie erst im zweiten Jahrhundert, wenn diese Texte zur christlichen Bibel zusammengestellt werden. Daher ist es sehr empfehlenswert, auch die Begegnung mit dem rabbinischen Judentum heute zu suchen. Natürlich ist dies nicht leicht, da Juden in unserer Gesellschaft seit der Schoa eine kleine Minderheit sind.
Sind Sie mit dem Fortgang des jüdisch-christlichen Gesprächs in den letzten Jahren zufrieden?
Es hat sich sehr viel entwickelt. Nach Jahrhunderten der christlichen Verachtung von Juden gleicht es einer Revolution, was innerhalb von 1.960 Jahren möglich wurde. Lokal und an der Basis waren die 1990er-Jahre und die Zeit bis gegen Corona hin Hochzeiten des Dialogs. Im Augenblick sind die Auseinandersetzung mit dem Islam und die israelische Politik im Vordergrund. Auch eine Dialogmüdigkeit ist festzustellen. Auf weltkirchlicher Ebene ist aber gerade seit 2015 sehr viel gelaufen, da auch die jüdische Orthodoxie mehr in den Dialog eingetreten ist.
„Auch eine Dialogmüdigkeit ist festzustellen.“
Christian Rutishauser
Kapitel 4 von "Nostra aetate": Das Judentum in drei Minuten
Welche bleibende Bedeutung hat dabei die Konzilserklärung „Nostra aetate“? Ist „Nostra aetate“ so etwas wie eine Pflichtlektüre für uns Katholikinnen und Katholiken?
Das Kapitel 4 von „Nostra aetate“ zum Judentum ist in drei Minuten gelesen. Jeder Gläubige sollte diese Zeilen kennen. Sie sind die Magna Charta des jüdisch-katholischen Dialogs. Doch man darf da nicht stehen bleiben. Die Forschung hat Enormes geleistet, so dass wir heute sehen, wie sich Judentum und Christentum erst in einem jahrhundertelangen Prozess ausdifferenziert haben. Dann gibt es wichtige Impulse aus Rom: Der Text der päpstlichen Bibelkommission zum jüdischen Volk und seiner Heiligen Schrift in der christlichen Bibel oder das Schreiben zu 50 Jahre „Nostra aetate“, das begründet, warum es keine Mission unter Juden mehr geben soll und trotzdem kein Abstrich am universalen Anspruch Christi gemacht wird.
Seit dem Jahr 2000 begehen die christlichen Kirchen in Österreich am 17. Jänner den „Tag des Judentums“ zum „bußfertigen Gedenken an die jahrhundertelange Geschichte der Vorurteile und Feindseligkeiten zwischen Christen und Juden und zur Entwicklung und Vertiefung des religiösen christlich-jüdischen Gesprächs“. Welche Bedeutung hat dieser Tag?
Der „Tag des Judentums“ ist ein wichtiger Impuls. Es braucht immer noch Aufarbeitung der Geschichte und neue Abwehr des Antisemitismus in all seinen Formen. Der Tag wird am 17. Jänner begangen, weil er vor der Woche für die Einheit der Christen steht. Es soll in erster Linie um ein tieferes Verstehen des Judentums und um die Erneuerung des christlichen Glaubens gehen. Karl Barth sagte kurz nach dem Konzil: „Die einzige wirklich große Frage der Ökumene ist die Beziehung der Kirchen zum Judentum.“
Judentum und Christentum sind religiöse Lerngemeinschaften
Was könnte und sollte Ihrer Ansicht nach getan werden, um das gegenseitige Verständnis zwischen Juden und Christen zu vertiefen?
Gemeinsam Lernen ist das Wichtigste, aus der Heiligen Schrift, aus Tradition, Literatur, Kunst. Das Judentum und das Christentum sind religiöse Lerngemeinschaften. Sie erheben den Anspruch, mehr als religiöse Folklore zu sein.
„Die jüdische Religion ist für uns nicht etwas ‚Äußerliches‘, sondern gehört in gewisser Weise zum ‚Inneren‘ unserer Religion. Ihr seid unsere bevorzugten Brüder, und, so könnte man gewissermaßen sagen, unsere älteren Brüder“, betonte schon Johannes Paul II. Wie kann das Judentum als Teil der christlichen Identität wertgeschätzt werden, und wie kann es gleichzeitig in seiner Verschiedenheit wahrgenommen werden?
Es ist wichtig, das Judentum nicht zu vereinnahmen. Oft meinen Christen, sie würden es verstehen, wenn sie das Alte Testament lesen. Doch die mündliche Tora (die Bücher Genesis bis Deuteronomium), die exegetische, halachische („rechtliche“), liturgische, literarische und philosophische Tradition des Judentums, die bis heute sehr lebendig ist, gilt es kennenzulernen, kurz gesagt: Juden wollen in ihrem Selbstverständnis wahrgenommen werden.
„Heilig-Land-Reisen sind auch eine Gelegenheit, dem Judentum zu begegnen.“
Christian Rutishauser
Judentum noch Querschnittsthema für das Christsein
Papst Franziskus schrieb im Jahr 2013 in „Evangelii Gaudium“ („Die Freude des Evangeliums“, Nr. 248): „Der Dialog und die Freundschaft mit den Kindern Israels gehören zum Leben der Jünger Jesu.“ Ist dieses Wissen im Alltag des kirchlichen Lebens und in der Liturgie und Verkündigung präsent?
Entscheidend ist die Ausbildung der Seelsorgenden, Religionslehrerinnen, Priester und kirchlichen Mitarbeiter. In einigen theologischen Fächern ist das Judentum sehr präsent, beispielsweise in der Exegese („Auslegung“), auch in der Gottesfrage ist es nicht mehr wegzudenken. Judaistik ist aber kein obligatorisches Fach – die Universität Luzern, wo ich arbeite, ist eine löbliche Ausnahme. Dennoch ist im kirchlichen Alltag die Beziehung zum Judentum oft noch vernachlässigt. Es ist nicht angekommen, dass das Judentum ein Querschnittsthema für das Christsein darstellt. Jüdische Feste werden am stärksten wahrgenommen. An Ostern ist oft ein Interesse auch am Pessach-Fest festzustellen. Heilig-Land-Reisen sind auch eine Gelegenheit, dem Judentum zu begegnen. Ich hoffe, dies wird bald wieder möglich – um des Friedens willen.
Von der Kraft der jüdischen Wurzel
Judentum und Christentum erkennen einander heute als Geschwister an. In der Geschichte aber gab es eine christliche Judenfeindschaft in Theologie und Glaubenspraxis, die im Lauf der Jahrhunderte Verfolgungen des Judentums und Leid von Juden und Jüdinnen bis hin zur Vernichtung ausgelöst hat.
1965 hat die katholische Kirche im Dokument „Nostra aetate“ des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962 bis 1965) einen neuen Weg eröffnet, auf dem wir seither unterwegs sind. Dennoch finden sich bis heute Auswirkungen des christlichen Antijudaismus in Liturgie und Verkündigung.
Das Symposion will dafür sensibilisieren, dass christliche Liturgie immer ein Feiern angesichts des Judentums ist; dass das Alte Testament nicht überholte Negativfolie, sondern Zeugnis des ungekündigten Bundes Gottes mit seinem Volk ist. Im Horizont der Tora-Auslegung des Jesus von Nazaret gewinnt die Verkündigung und Glaubensvermittlung an Weite und Tiefe.
Die Tagung möchte anhand von exemplarischen Themenfeldern für Kirchen in der christlichen Ökumene Handlungsperspektiven für Liturgie und Verkündigung erschließen und bewusst machen, welch großes Potential Christinnen und Christen aus der Kraft der jüdischen Wurzel ihres Glaubens geschenkt ist.