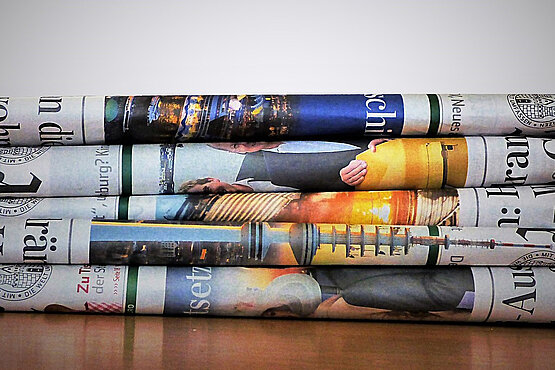„Beim Würfelspiel werden Grenzen überwunden“
Blutgericht auf dem Haushamerfeld
Was passierte vor 400 Jahren im oberösterreichischen Frankenburg? Als im Mai 1625 von der Obrigkeit ein römisch-katholischer Geistlicher eingesetzt werden sollte, kam es zum Aufstand der evangelischen Bauern. Der katholische Statthalter Adam Graf von Herberstorff versprach den Aufständischen „Gnade“, falls sie unbewaffnet am 15. Mai zum Haushamerfeld kämen. 5.000 Bauern folgten dem Aufruf. Doch statt der vermuteten Gnade für die Aufständischen wurden 36 führende Männer festgenommen. Der Statthalter ließ sie paarweise um ihr Leben würfeln. 16 der „Verlierer“ und eine weitere Person wurden anschließend gehängt. Herberstorff verfügte zudem, dass die gesamte Bevölkerung bis Ostern 1626 wieder zur katholischen Kirche übertreten müsse. Evangelische Gottesdienste wurden endgültig verboten, evangelische Geistliche und Lehrer wurden des Landes verwiesen. Für die evangelischen Christen brachen schlimme Zeiten an.
Historische Hintergründe des "Würfelspiel"
Wer sich für die historischen Hintergründe des Schauspiels interessiert, ist im Frankenburger Würfelspielhaus nahe der Freilichtbühne richtig. Im Erdgeschoss wurde ein Museum eingerichtet, das aktuell mit zahlreichen neuen Attraktionen aufwartet. So gibt es etwa 3D-Animationen und ein Escape-Room-Abenteuer im Obergeschoss. Ein Prunkstück des Museums sind drei ausgestellte Würfel. „Experten haben uns versichert, dass die Würfel zumindest aus der passenden Zeit des Dreißigjährigen Kriegs stammen.“ Einer der Würfel ist übrigens gezinkt.
Beim Würfelspiel verloren und gehenkt
Das Laienschauspiel, das im Zweijahresrhythmus aufgeführt wird, schweißt den Ort zusammen. 400 Leute spielen mit, nochmals so viele sind anderwärtig beteiligt, berichtet „Würfelspiel“-Obmann Michael Neudorfer: „Wenn es um das Würfelspiel geht, werden auch Grenzen überwunden, sogar politische Grenzen, die sonst den Alltag mitbestimmen.“ Der Großvater von Neudorfer spielte schon bei der Erstaufführung des Spiels 1925 mit. Er selbst hat sich vom zwölfjährigen Komparsen zum Christoph Stratter hochgedient. Dieser ist einer der Unglücklichen, die beim Würfelspiel verloren und gehenkt wurden.
Gedenken an das Frankenburger Würfelspiel
Zum 300-Jahr-Gedenken wurde das „Frankenburger Würfelspiel“ erstmals aufgeführt. Als Schauspiel verfasst wurde es vom oberösterreichischen Schriftsteller Karl Itzinger. Der schon von Itzinger reichlich deutschnational gefärbte Text wurde von den Nazis nochmals ordentlich zugespitzt, erläutert die frühere evangelische Oberkirchenrätin Hannelore Reiner, die auch im Frankenburger Würfelspielteam engagiert ist. Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs galt es als NS-Stück und wurde wieder umgeschrieben. Unter anderem wurden antikatholische Stellen entfernt, das Schauspiel wurde auch immer mehr zu einem Stück über einen sozialen Aufstand. Später wurde der Kirchen- konflikt wieder stärker aufgenommen, an anderen Stellen wurde auch den Frauen mehr Aufmerksamkeit zuteil. Seit 1999 gibt es rund um die jeweilige Spielzeit auch einen ökumenischen Gedenkgottesdienst.
Seit 2019 hört das Stück auch nicht mehr mit dem Tod der Bauern auf, sondern beleuchtet auch die Zeit danach, als viele Bauern, die ihren evangelischen Glauben nicht aufgeben wollten, die Heimat verließen. Das Perfideste dabei: „Alle Kinder bis 12 Jahre mussten sie zurücklassen. Der Kaiser brauchte schließlich arbeitsfähige Untertanen“, berichtet Obmann Neudorfer. Trotzdem zogen viele Bauern weg. Inzwischen gibt es gute Beziehungen zwischen den Frankenburgern und den Nachkommen der Ausgewanderten, die zum Jubiläum auch nach Frankenburg kamen.
Würfelspiel: Weit mehr als Nostalgie
In Frankenburg bemüht man sich um eine stetige Aufarbeitung der Geschichte. Stolz präsentiert Hannelore Reiner das Ergebnis eines Schulprojekts: „Frankenburg 1625. Jugendliche schreiben zurück“ heißt die Sammlung an Texten, die Mädchen und Buben der Mittelschule Frankenburg verfassten. Das Gedicht eines 13-jährigen Mädchens hat es Reiner besonders angetan, in dem dieses in Mundart die Geschehnisse aus der Sicht eines verurteilten Bauern aufarbeitet: „Ich fürcht, des ist unser Tod! Der Wind fahrt in d’Lindn. In der Uhr rinnt der Sand. Der Herr is bei eam und reicht eam de Hand.“
Es geht beim Würfelspiel jedenfalls um weit mehr als nur Nostalgie. Michael Neudorfer formuliert es so: „Es geht uns darum, das Bewusstsein für Tendenzen zu schärfen, die unsere demokratische Gesellschaftsordnung und unsere Werte, ja die Menschenrechte an sich aufs Spiel setzen.“
Termintipp
Das „Frankenburger Würfelspiel“ läuft noch bis 17. August: ▶ wuerfelspiel.at