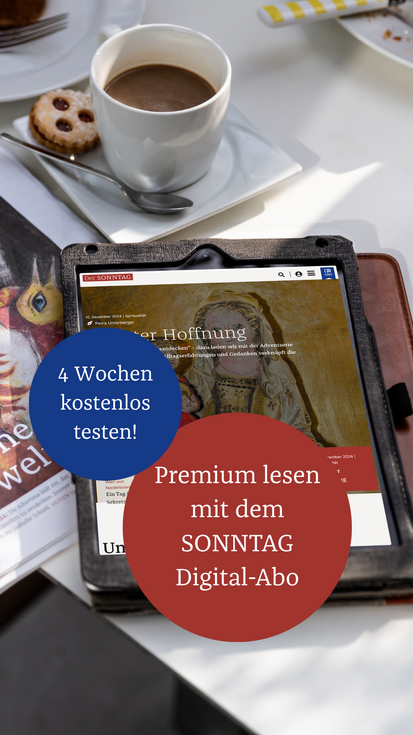„Lux perpetua“ – Vom Licht, das bleibt und klingt
Musikalische Lichtbringer
„Lux perpetua“ beispielsweise. Diese Worte stehen am Beginn des Introitus im Requiem-Text der katholischen Liturgie, jener musikalischen Form, die wie keine andere zwischen Diesseits und Jenseits vermittelt. Und es ist mehr als nur ein Trostbild für die Hinterbliebenen: Es ist ein Versprechen: „… und das ewige Licht leuchte ihnen.“
Licht als klangliche Vision
Die Vorstellung eines ewigen Lichts, das den Verstorbenen leuchtet, ist tief verwurzelt in der christlichen Symbolik. Licht steht für Erkenntnis, für göttliche Gegenwart, für Transzendenz.
In der Musik wird dieses Motiv seit Jahrhunderten aufgegriffen – nicht nur als Metapher, sondern als klangliche Vision. Komponisten wie Mozart, Fauré oder Duruflé haben dem „lux aeterna“ musikalische Gestalt verliehen, jeder auf seine Weise: mal schwebend und entrückt, mal warm und tröstlich, mal mystisch und geheimnisvoll.
Licht als Strukturgeber
Mozarts Requiem etwa beginnt mit einer düsteren Klanglandschaft, doch schon im „Lux aeterna“ öffnet sich der Raum: Die Musik wird heller, die Stimmen steigen auf, als wollten sie das Licht selbst berühren. Bei Fauré ist das Licht von Anfang an präsent – sein Requiem ist kein dramatischer Abgesang, sondern ein leiser Übergang, ein musikalisches Gebet, das sich in Licht auflöst. Und Duruflé lässt das gregorianische „Lux aeterna“ in impressionistische Farben tauchen – ein Leuchten, das aus der Tiefe kommt.
Was diese Werke eint, ist die Verbindung von Text und Ton, von spiritueller Botschaft und musikalischer Form. Das Licht ist nicht nur Thema, sondern Strukturgeber: Es bestimmt die Dynamik, die Harmonik, die Klangfarbe. In der geistlichen Musik wird Licht hörbar gemacht – als Hoffnung, als Sehnsucht, als Ziel.
Licht als universale Energie
Auch in der zeitgenössischen Musik bleibt das Licht ein zentrales Motiv. György Ligeti etwa lässt in seinem „Lux aeterna“ die Stimmen wie Lichtstrahlen durch den Raum schweben – ein Stück, das durch Stanley Kubricks „2001: A Space Odyssey“ weltberühmt wurde und die metaphysische Dimension des Lichts in eine neue, in dem Fall „außerirdische“ Klangsprache überführt.
Hier wird das Licht nicht mehr nur als religiöses Symbol verstanden, sondern als universale Energie, als Zustand jenseits von Zeit und Raum, was sofort an den größten „Lichtmusiker“ denken lässt: Karlheinz Stockhausen. Sein monumentaler „Licht“-Zyklus – sieben Opern für die sieben Wochentage – sprengt alle Maßstäbe. Hier wird Licht zur kosmischen Chiffre, zur esoterischen Formel, zur multimedialen Vision. Man kann sich dem kaum entziehen, auch wenn man nicht alles versteht. Oder wie ein befreundeter Musiker einmal sagte: „Stockhausen hat das Licht nicht nur vertont – es wirkt, als hätte er es gleich selbst erfunden.“
Tipps zum Weiterhören
In Richard Strauss Oper „Daphne“ gibt es die berühmte Mondlichtmusik, in Liszts „Transzendentalen Etüden“ begegnet man Irrlichtern, der russische Komponist Andrei Eshpai (aus der Volksgruppe der Mari) komponierte die Symphonie „Lob des Lichts“ und das letzte Werk des wohl „leisesten“ Komponisten, Morton Feldman, beschäftigt sich mit der koptischen Webkunst und nennt sich „Coptic Light“.

Radio-Tipp
radio klassik Stephansdom Chefredakteur Christoph Wellner präsentiert die beschriebene Lichtmusik am 10. Dezember 2025 um 11:00 Uhr in der Sendung „Rubato“. Digital empfangen Sie radio klassik Stephansdom in ganz Österreich über DAB+.