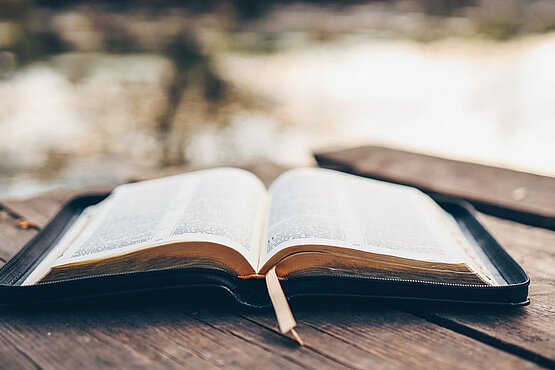Comeback des Fastens
Was wir der Kirche verdanken
Es ist paradox: Während die kirchlichen Fasttage, früher Freitag und auch Mittwoch, immer mehr auf den Aschermittwoch und den Karfreitag reduziert wurden, wird gegenwärtig aus ästhetischen und medizinischen Motiven gefastet wie noch nie. „Fastenseminare“ boomen, die Wellness-Industrie auch.
Die Kirche kennt den Aschermittwoch und den Karfreitag als strenge Fast- und Abstinenztage: Gemeint sind eine einmalige Sättigung (Fasten) und der Verzicht auf Fleischspeisen (Abstinenz). Wobei nicht vergessen werden darf, dass die Kirche nach wie vor auch das sogenannte „Freitagsopfer“ kennt. Es beinhaltet in erster Linie den Verzicht auf Fleischspeisen, daher der beliebte Fisch am Freitag, sowie tätige Nächstenliebe. Der von der Katholischen Frauenbewegung Österreichs 1958 erstmals begangene „Familienfasttag“ (immer am zweiten Freitag in der Fastenzeit, heuer am 23. Februar) stellt konkret das Teilen in den Mittelpunkt. Das dadurch Ersparte kommt den Menschen im Süden zugute – sozusagen ein modernes „Freitagsopfer“.
Richtiges und falsches Fasten
Viele Religionen und Kulturen kennen ein Fasten als zeitweiligen Verzicht auf Essen und Trinken, auch die Kirche hat das Fasten immer hochgeschätzt. Aber sie weiß auch um die Gefahren. Ganz harsch wird etwa der Prophet Jesaja (58,5–6), wenn er für richtiges Fasten plädiert: „Ist das ein Fasten, wie ich es wünsche, ein Tag, an dem sich der Mensch demütigt: wenn man den Kopf hängen lässt wie eine Binse, wenn man sich mit Sack und Asche bedeckt? Nennst du das ein Fasten und einen Tag, der dem HERRN gefällt? Ist nicht das ein Fasten, wie ich es wünsche: die Fesseln des Unrechts zu lösen, die Stricke des Jochs zu entfernen, Unterdrückte freizulassen, jedes Joch zu zerbrechen?“ Jesus selbst fastete zu Beginn seiner öffentlichen Tätigkeit 40 Tage und Nächte in der Wüste (vgl. Matthäusevangelium 4,2). Er findet später klare Worte zum falschen Fasten (Matthäusevangelium 6,16): „Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler! Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten.“
Besser: die Vorösterliche Bußzeit
Im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich am Karfreitag und Karsamstag das „Trauerfasten“, das dann auf die Karwoche und später auf die 40 Tage vor Ostern ausgedehnt wurde. Ausgenommen waren immer schon die Sonntage, die bis heute keine Fasttage sind. Die Fastenzeit dauert heutzutage vom Aschermittwoch bis zum Beginn der Abendmahlsmesse am Gründonnerstag.
Ausgehend von der Taufe hat die Fastenzeit ein großes Ziel: ein neuer, innerlich freier, österlicher Mensch zu werden, ausgerichtet auf Christus. Damit wird sichtbar, dass die sogenannte „Fastenzeit“ nur ein Teilaspekt der „Vorösterlichen Bußzeit“ ist, wie der bessere Name für diese 40 Tage lautet. Diese „Quadragesima“ („40-Tage-Zeit“) dient der Vorbereitung auf die Feier des Todes und der Auferstehung Christi – durch Taufgedächtnis und tätige Buße.