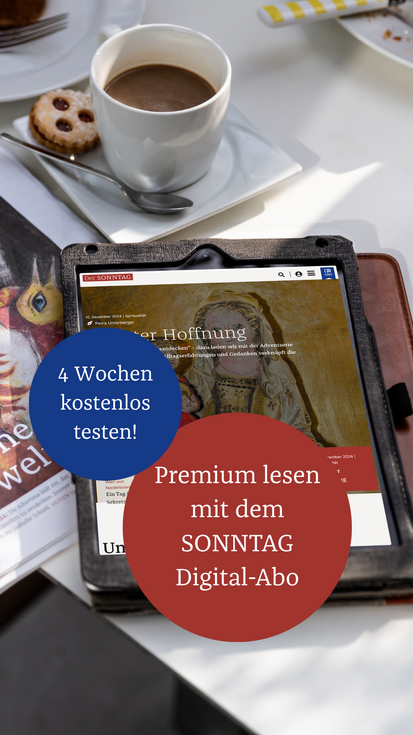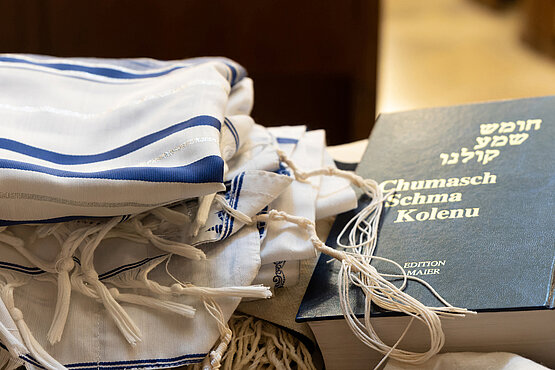Thomas de Maizière: "Ich habe kein Vorbild"
Politik und KircheDas hoch über der Donau gelegenene Stift Göttweig bietet einen interessanten Rahmen für Austauschtreffen. Der SONNTAG traf beim elften Familienunternehmertag den ehemaligen Spitzenpolitiker Thomas de Maizière zum Gespräch.
Herr Dr. de Maizière, wir sind hier auf dem elften Familienunternehmertag in Stift Göttweig in Niederösterreich. Fühlen Sie sich wohl in einem katholischen Benediktinerstift?
Na klar. Der Hintergrund der Frage ist, dass ich aus einer protestantischen, hugenottischen Familie komme. Ich bin auch in meiner Kirche engagiert. Ich war Synodale in der sächsischen Landeskirche. Ich bin im Vorstand des Deutschen Evangelischen Kirchentages, ich war Präsident des Kirchentages in Nürnberg. Ich war auf einer katholischen Jesuitenschule in Bonn als Schüler.
Ist das jetzt gefährlich?
Nein. Meine ersten beiden Freundinnen, waren katholisch, Aber ich bin schon evangelisch geprägt, keine Frage. Aber ich stehe mit Respekt hier vor der kulturellen Leistung der Klöster, die ja eigentlich den Wissenstransfer über Jahrhunderte sichergestellt haben. Was wir heute in Clouds und auf dem Server haben, haben die Mönche abgeschrieben und aufgeschrieben. Mal sehen, ob unsere Serverinhalte so lange halten wie diese alten Texte.
Ich stehe mit Respekt hier vor der kulturellen Leistung der Klöster
Manche Manager lassen sich ja auch vom heiligen Benedikt inspirieren und anleiten. Es gibt sogar Seminare für Manager. Da reisen Menschen an und verbringen hier spirituelle Einheiten, lassen sich von Äbten oder von Mönchen weiterbilden.
Eine meiner Thesen ist, dass gute Führung Ablenkung braucht, damit man sich auf die eigentliche Kernaufgabe der Führungsaufgabe konzentrieren kann. Und Auszeiten, wie Fastenzeiten, wie Klausurtagungen, wie das Pilgern ist eine solche Form von Ablenkung. Ich bin hier in einem wunderbaren Gästezimmer untergebracht. Dort steht kein Fernseher. Und am Anfang habe ich mich geärgert. Ich wollte gestern Abend noch die Nachrichten sehen und dann stand in dem Büchlein: “Wir setzen bewusst darauf, dass es in unseren Zimmern keine Fernseher gibt. Wir wollen das Stille einkehrt.” Und dann bin ich stumm geworden und habe gedacht: Genauso ist es. Diese Form von etwas ganz anderem machen und das als eine Kraftquelle und Anker erleben zu dürfen, das können Klöster in ganz besonderer Weise.
Thomas de Maizière: Lesen und Musik als Auszeit
Sie haben Auszeiten angesprochen. Wo haben Sie denn in Ihren 40 Jahren in der Politik Auszeiten gehabt?
Zu wenig, natürlich. Ich bin ein bisschen wie der Prediger in der Wüste. Aber für mich war das Lesen und die Musik, vor allen Dingen das Hören von sehr guter Musik eine Auszeit. Ich kann in Musik, versinken, wenn ich die h- Moll Messe vom Bach höre oder die Matthäuspassion oder eine Bruckner Symphonie. Oder wenn ich ein großes Buch lese, dann bin ich so weit weg von allem, dass es schön ist, wieder aufzutauchen.
Eine meiner Thesen ist, dass gute Führung Ablenkung braucht
Kommen wir zurück zu Ihrem Vortrag. Sie haben referiert über Bedingungen von Führung in Politik und Wirtschaft und haben Unterschiede und Gemeinsamkeiten herausgearbeitet. Sie sagten: “Wer führt, muss Menschen mögen.” Was steckt dahinter?
Wer gut führt, muss Menschen mögen, würde ich vielleicht präzise sagen. Wenn Sie Verantwortung für Menschen haben und die Menschen den Eindruck haben, sie mögen sie eigentlich nicht, dann gelingt Führung nicht. Damit meine ich keine persönlichen Liebesbeziehungen oder große Sympathie für Einzelne, aber wenn Sie Kultusminister sind, müssen Sie Lehrer mögen. Wenn Sie Gesundheitsminister sind, müssen Sie Ärzte und Pflegekräfte mögen. Sie müssen das Milieu mögen. Wenn die Menschen das Gefühl haben, dass man sich nur aus taktischen Gründen anbiedert, dann gelingt Führung nicht. Also zu guter Führung zählt, dass man die Menschen ernst nimmt und sie Zuwendung und Anerkennung spüren lässt. Aber man muss mit Respekt für die Aufgabe auch nach Innen Kritik üben können.
Sie meinen außerdem, dass mann Institutionen wie dem Staat und seinen Politikerinnen und Politikern wie auch Institutionen wie unseren Kirchen, Problemlösungen nicht zutraut. Warum eigentlich?
Ich glaube schon, dass wir jedenfalls in Deutschland, vielleicht auch im Westen, in einer Institutionenkrise sind. Die Institutionen hatten auch ihre Skandale: die Kirchen, große Sportverbände oder Parteispendenskandale in der Politik. Dagegen sind aktuell kleine Initiativen chic wie die selbstgewählte Stiftung, Demos für Fridays für Future oder Spenden für ein Projekt in Afrika. Das sind sehr lobenswerte Aktivitäten. Aber diverse Gesellschaften brauchen zusammenführende, kontinuierliche, dauerhafte Institutionen. Eine Freiwillige Feuerwehr muss immer da sein. Tag und Nacht. Also dauerhafte Bindungen in Institutionen gehören zur Stabilität einer Gesellschaft. Ich werbe dafür, dass wir Institutionen nicht schlechtreden, nicht verachten, sondern in sie hineingehen und gegebenenfalls positiv verändern.
Dauerhafte Bindungen in Institutionen gehören zur Stabilität einer Gesellschaft.
Man spricht auch vom Engagement der Zivilgesellschaft. Die Kirchen, die Glaubensgemeinschaften, sind hier doch Global Player.
Ja, ich beklage auch kein mangelndes Engagement, das ist immer noch großartig. Aber wichtig ist nicht nurein Einzelengagement, sondern auch mal in den Kirchenvorstand zu gehen und fünf oder sieben Jahre lang einmal im Monat eine dreistündige, langweilige Sitzung zu haben, um zu entscheiden, welches Geld jetzt ausgegeben wird, ob jetzt der Kirchenturm renoviert wird oder ob man lieber die Orgel macht und Spenden zu sammeln für die Orgel. Diese Form von nicht spektakulärer, aber dauerhafter, nachhaltiger Arbeit in Institutionen, dafür werbe ich, dass das nicht verloren geht.
Thomas de Maizière über die Arbeit als Spitzenpolitiker
Wie haben Sie die Zeit gefunden für Ihr Engagement in evangelischen Kirche?
Ich fand es immer nötig, neben meinem Kerngeschäft auch andere Dinge zu machen und bin ein evangelischer Christ und die evangelische Kirche, jedenfalls wirbt auch um Menschen, die nicht nur im Ruhestand sind, oder die in kirchlichen Organisationen sind, sondern um Menschen, die im prallen Leben sind und als Laien die Kirche mit ihrem Engagement befördern. Es kommt aber noch eins hinzu: Als Politiker oder gar Spitzenpolitiker sind Sie zu eng in ihrem Milieu. Und da ist der Aufenthalt in anderen Milieus, das Eintauchen in eine andere Sprachgebräuche, der Austausch mit anderen Menschen sehr wichtig. Für mich war das jedenfalls wichtig. Und Kirche war für mich wie Sport oder Musik eine der Quellen, wo ich aufgetankt habe.
Sie haben ein Buch zum Thema geschrieben “Die Kunst des guten Führens”, gemeinsam mit Karl-Ludwig Kley. Er war Spitzenmanager bei Lufthansa und beim Pharmakonzern Merck. Welche Essenz würden Sie uns mitgeben wollen?
Wir haben ein Buch geschrieben über die Kunst guten Führens in Wirtschaft und Politik und haben herausgearbeitet, dass es unterschiedliche Erfolgs- und Handlungsbedingungen gibt. Ein Spitzenmanager muss nicht wiedergewählt werden, auch wenn sein Vorstandsvertrag vielleicht endet, aber das Unternehmen muss Erfolg haben. Politische Arbeit ist öffentlich – Führen in Unternehmen ist nicht annähernd so öffentlich. Das wechselseitige Verständnis von Verantwortlichen aus der Wirtschaft für die Zwänge der Politik und umgekehrt das Verständnis der Politik für die Zwänge und Herausforderungen der Wirtschaft sind schlecht ausgebildet. Man versteht sich nicht. Man kritisiert sich, man redet nebeneinander her und es entstehen Vorwürfe. Und das ist schlecht für das Gelingen einer Gesellschaft. Wirtschaft und Politik können streiten über bestimmte Maßnahmen, aber sie müssen voneinander wissen, was der oder die jeweils Verantwortliche macht. Das war das Anliegen des Buches.
Sie haben auch erklärt, wie viele ungebetene Ratschläge Politikerinnen und Politiker erhalten und zwar zusätzlich auch mit Forderungen aber ohne Pläne für eine mögliche Umsetzung.
Das ist in der Tat so, dass man für die Führung einer politischen Institution jede Menge Ratschläge von außen bekommt, übrigens auch von der Opposition aus dem Politikbetrieb. Journalisten wissen auch immer alles besser und die Wissenschaft weiß es besser und die Wirtschaft weiß es besser. Übrigens, oft widersprechen sich die Vorschläge. Aber nach meiner Erfahrung beziehen sie sich oft darauf, was gemacht werden soll. Sollen die Steuern gesenkt werden, sollen sie erhöht werden? Es soll mehr Geld für Bildung ausgegeben werden, es soll mehr für die Umwelt gemacht werden. Alles gut und schön, aber wie man das macht, vor allem, wenn die Mehrheit anderer Meinung ist, und wie man das durchsetzt, da gibt es zu wenig Ratschläge.
Als Politiker oder gar Spitzenpolitiker sind Sie zu eng in ihrem Milieu.
Sie sind, das kann man einfach so zusammenfassen, ein politischer Mensch. Sie kommen aus einer politischen Familie. Ihr Vater gilt als Vater der Bundeswehr nach dem Zweiten Weltkrieg. Wieso haben Sie politischen Aufgaben angenommen und auch übernommen?
Wir haben zu Hause am Küchentisch politisch diskutiert. Wir sind vier Geschwister. Und das Interessante war, dass meine Eltern ein Erziehungsprinzip hatten, das lautete: Man darf eine andere Meinung haben als die Eltern, aber man muss sie begründen. Das war der erste Punkt. Also Streit, Dialog, Gespräch ist mir in die Wiege gelegt. Das Zweite ist, ich bin, das hat vielleicht auch mit protestantischer Ethik zu tun, so erzogen worden, dass man sich für die Gesellschaft engagiert, wenn man was kann und nicht einfach nur vom Stamme “Nimm” ist. Und das Dritte ist: Ich wollte Dinge auch verändern. Schon in der Schule und an der Hochschule. Eines meiner wichtigsten Engagements in der Hochschule war, dass nach unserer Auffassung das juristische Seminar der Universität Münster schlechte Öffnungszeiten hatte. Die machten um 17:00 Uhr zu und wir wollten vielleicht später anfangen, aber bis 22:00 Uhr die Bibliothek geöffnet haben. Also sind wir in den Fachschaftsrat gegangen und haben dafür geworben.
Da waren sie aber fleißige Studenten, wenn sie bis 22:00 in die Bibliothek wollten!
Wenn man erst um 17:00 Uhr anfängt, weil man so lange gefeiert hat, dann muss man büßen und nachholen. Ernsthaft: Es heißt, über den Tellerrand der eigenen Kehre hinaus gucken und etwas zu verändern, habe ich als Pflichtgefühl mitbekommen und dann aber als Erfolgserlebnis erfahren. Und das fand ich gut.
Es heißt, über den Tellerrand der eigenen Kehre hinaus gucken und etwas zu verändern.
Waren Sie, weil Sie Ihr Studium angesprochen haben, mit Ihrer sehr soliden, juristischen Ausbildung inklusive Promotion und Ihrer Ausbildung als Soldat in der Bundeswehr gut gerüstet für die Politik?
Ja, der bewusste Umgang mit Sprache, die Strukturierung von Themen und Problemen sind wichtig. Nicht nur Problembeschreibung, sondern Problemlösung, das habe ich als Jurist gelernt. Und bei der Bundeswehr als Soldat lernte ich ganz andere Menschen kennen. Die hatten kein Abitur, mit einem anderen Sprachgebrauch, die uns aber halfen, wenn wir plötzlich schlapp machten.Das nennt man bei der Bundeswehr Kameradschaft. Dass es ein Grundgefühl von gemeinschaftlicher Verantwortung gibt, das habe ich bei der Bundeswehr gelernt.
Ist es zu abgedroschen, Sie zu fragen, wer Ihr Vorbild in der Politik war? Aber es würde mich interessieren.
Ich habe kein Vorbild, kein lebendes Vorbild. Ich bin auch mit Vorbildern sehr kritisch. Wenn sie tot sind, ist es kein Wunder, dass sie Vorbilder sind, weil man nur die guten Sachen in Erinnerung behält. Und bei den Lebenden, da hat man doch immer irgendetwas auszsetzen. Aber ich bin natürlich sehr geprägt worden von Richard von Weizsäcker, obwohl ich gar nicht so lange bei ihm gearbeitet habe. Von Kurt Biedenkopf - einer der wenigen, die Intellektualität und politische Führung miteinander verbunden haben. Von Angela Merkel natürlich, obwohl wir gleich alt sind. So, das sind schon Menschen, die mich sehr geprägt haben. Wolfgang Schäuble, der gerade verstorben ist, und einige andere mehr. Ich habe jedenfalls versucht, immer von anderen, auch von Kollegen etwas abzugucken, sie zu beobachten, sie auch zu kritisieren, mich kritisieren zu lassen.
Thomas de Maizière über konservative Politik
Sie sind seit 1971 Mitglied der CDU. Sie haben in diesem Jahr 2024 ihren 70. Geburtstag gefeiert. Wenn man an Ihre politisch aktive Zeit denkt, gelten Sie gemeinhin als Konservativer. Was ist denn einem Konservativen ein Anliegen in der Politik?
Die CDU besteht aus liberalen, christlichen und konservativen Elementen. Und da muss man immer beschreiben, was konservativ eigentlich ganz genau ist. Ich glaube, konservativ ist zunächst nicht eine inhaltliche Position, sondern eine Haltung. Dass man sich selbst nicht so wichtig nimmt wie die Sache. Dass das Gemeinwohl immer auch mit betrachtet werden muss, wenn man sich gesellschaftlich engagiert. Dass man ein paar Manieren hat. Das finde ich konservativ im guten Sinne. Konservativ ist aber umgekehrt nicht, Sehnsucht nach guten alten Zeiten zu haben, die es sowieso kaum gab. Dazu gibt es den wunderbaren von Loriot: “Früher war auch mehr Lametta.” Besser kann man eigentlich die falsche Sehnsucht nach früher nicht beschreiben. Konservativ sein heißt auch , Stabilität im Wandel herbeizuführen. Wandel ja, aber nicht revolutionär, sondern so, dass die Menschen das verstehen, dass sie möglichst mitmachen.
Politiker haben allgemein einen sehr schlechten Ruf. Das wandelt sich dann, wenn die Menschen in Pension sind, dann warden sie eingeladen zu Vorträgen wie Sie heute. Wieso passiert das erst nach der aktiven Zeit?
Ja, vielleicht ist das nicht nur bei Politikern so, sondern auch sonst. Menschen vergessen oft schlechte Dinge und behalten die guten. Ehemalige Politiker wie ich reden auch offener, abgeklärter, nicht so in Sprechblasen und nicht in diesen Interview-Textbausteinen. Man ist irgendwie gnädiger mit den älteren Menschen. Erklären kann ich es mir nicht, aber nicht schlecht.
Sie haben mir gerade in unserem Gespräch bis jetzt die Phrase erspart: “Ich will ganz offen sein.” Wenn Politiker in diese Redewendungen verfallen, überlege ich, ob sie sonst nicht offen sind?
Das finde ich auch. Oder: “Ich will mal ehrlich sagen”. Das heißt doch im Grunde, dass ich in 90 Prozent der Aussagen lüge! Es gibt aber auch andere Dinge, die mich ärgern: Wenn alle immer “genau” sagen. Das ist eine Sprachfloskel! Oder das “Also”, das hat auch so was Belehrendes.
Menschen vergessen oft schlechte Dinge und behalten die guten.
Wir beide wissen als als gelernte Europäer und die europäische Geschichte kennend, dass sehr viel Schwieriges passiert ist mit der Staatskirche. Haben Sie Tipps, wie die Politik die Kirchen in der Leitung unterstützen könnte?
Es gibt jedenfalls in meiner Kirche, in der evangelischen Kirche, eine Scheu vor der Macht. Das Wort darf nicht ausgesprochen werden. Es heißt dann geschwisterliche Leitung. Mehrheiten, Positionskämpfe sind angeblich unbeliebt. Aber siefinden unter dem Tisch trotzdem statt. Und umgekehrt ist in der katholischen Kirche das Amt nach meiner Wahrnehmung mit zu viel Hierarchie verbunden. Was auch dogmatisch begründet wird. Das Amt und damit die Person darf eigentlich nicht in Frage gestellt warden, sonst wird die ganze Institution in Frage gestellt. Ich wünsche mir also: ein bisschen mehr in meiner Kirche, was die Binnenstruktur angeht, sehen, dass große Organisationen auch Führung brauchen und umgekehrt bei der katholischen Kirche, dass Führung auch hinterfragt werden darf.
Und der zweite Rat, den ich geben würde. Politik wird immer dann kritisiert, wenn sie sich zu mit sich selbst beschäftigt ist. Aber im Grunde verlangt die Bevölkerung, dass die Politik ihre Arbeit macht, auch wenn die Inhalte umstritten sind. Und im Moment sind die Kirchen in der Gefahr, die Selbstbeschäftigung so zu übertreiben. Ja, aus nachvollziehbaren Gründen wie dem Missbrauchsskandal und dem Mitgliederrückgang, das verstehe ich. Aber darunter droht der innerste Kern, nämlich sich aus christlicher Zuversicht nach außen zu wenden, unter die Räder zu kommen.
Wir wissen, dass die deutschen Kirchen sehr reich sind aufgrund der Einnahmen durch die Kirchensteuer. Hat man eigentlich den Kirchen am Ende des Tages, wenn Sie auch die Probleme ansprechen, einen guten Dienst mit der Kichensteuer erwiesen?
Es gibt darüber auch eine noch nicht offen geführte Diskussion. Wen man mal guckt, wer tritt eigentlich aus aus der Kirche, dann sind es meistens oder oft junge Familien, die zum ersten Mal verdienen. Dann sehen sie auf ihrer Gehaltsrechnungen, dass 10 % der Einkommensteuer abgezogen wird. Da sagen Viele: Und was habe ich davon? Deswegen empfehlen jetzt manche: Schafft die Kirchensteuer ab, dann hat man das Problem nicht mehr. Andererseits: mit einer dauerhaft, soliden Finanzierung haben die Kirchen auch viel Gutes im diakonischen Bereich getan. Man stelle sich einmal vor, unsere Kirchgebäude würden alle verfallen. Dann hätten wir einen kulturellen Verlust ohnegleichen. Aber ich glaube trotzdem, wir müssen in Deutschland eine Diskussion beginnen über die Art und Weise, wie sich die Kirchen finanzieren. Es gibt das österreichische Modell, es gibt andere Modelle, wo man sich selbst einschätzt und besteuert. Es gibt Modelle, wo man den Zweck bestimmen kann. Das kann man alles diskutieren. Aber einfach nur den Mitgliederrückgang zu beklagen und die Kirchensteuer nicht zu verändern, das ist, so glaube ich, nicht zukunftsfähig.