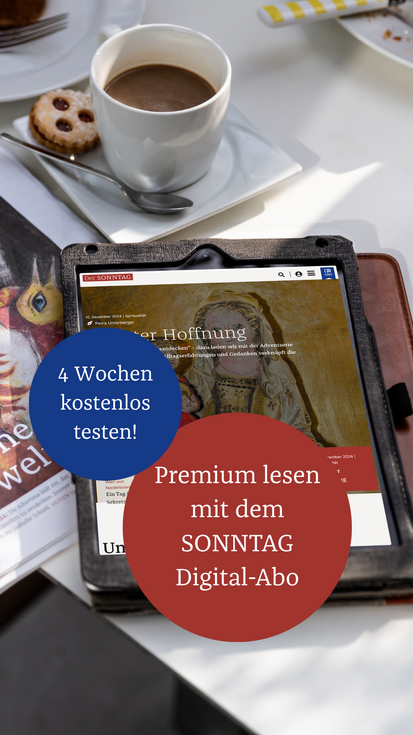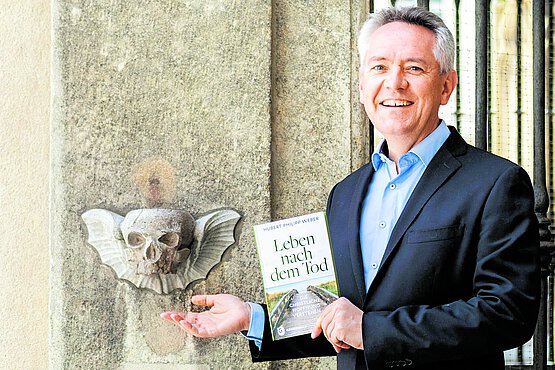Krisenmanager Gottes: Gregor der Große
Bedeutende Päpste – Folge 2
Die Bibel ist wie ein Strom, der so flach ist, dass ein Lamm daraus trinken kann, und so tief, dass ein Elefant darin baden kann.“ Dies schrieb jener Papst, der als erster großer Theologe und als erster Mönch auf dem Stuhl des Petrus in Rom wirkte: Gregor der Große. Gregor wurde um 540 in Rom geboren – er stammte aus einer christlichen Familie, die Rom durch Generationen geprägt hat. Sein Weg führte ihn in die öffentliche Verwaltung, 572 wurde er Stadtpräfekt. Doch schon wenige Jahre später gestaltete Gregor die Villa der Eltern in ein Benediktiner-Kloster um. Hier konnte er die Heilige Schrift studieren und die Kirchenväter lesen.
Nach der Weihe zum Diakon 578/79 wurde er als sogenannter „Apokrisiar“, vergleichbar einem heutigen Apostolischen Nuntius, vom Papst nach Konstantinopel geschickt, um dort theologische Fragen zu klären. Er lernte die byzantinische Welt vor Ort und auch das Problem mit den Langobarden kennen. Die Langobarden werden ihn dann bis zu seinem Lebensende beschäftigen. Nachdem er vom Papst nach Rom zurückgerufen wurde, war Gregor als Sekretär des Papstes auch mit dem tristen Alltag beschäftigt: Hungersnöte und dazu noch die Pest. An dieser Pest starb auch Papst Pelagius II. und 590 wurde Gregor vom Klerus, vom Volk und vom Senat zu seinem Nachfolger gewählt. Mehr als 800 Briefe sind von ihm erhalten, die auch von seiner täglichen Arbeit berichten.
Hl. Gregor der Große
Leben: um 540 bis 604
Kirchlicher Gedenktag: 3. September
Papst: vom 3. September 590 bis zum 12. März 604
Patron: des kirchlichen Schulwesens, des Chor- und Choralgesangs, der Bergwerke
Die Sorge um die Langobarden
Der christliche Umgang mit den Langobarden war ihm ein Herzensanliegen. Er wollte zum einen die Expansion der Langobarden in Italien bremsen, und zum anderen mit Hilfe der katholischen Königin Theudelinde die Langobarden zum katholischen Glauben führen. Letztlich wollte Gregor einen Ausgleich erzielen zwischen den Langobarden und den Byzantinern, deren oströmisches Kaiserreich sich auf der italienischen Halbinsel erstreckte. Gregor dachte auch an die jungen Völker Europas, die Westgoten Spaniens, die Franken, die Sachsen, die Einwanderer Britanniens. So schickte er den hl. Augustinus von Canterbury als Führer einer Gruppe von Mönchen nach Britannien, um England zu evangelisieren.
Der „Konsul Gottes“
Bald nannte man Papst Gregor „Consul Dei“, „Konsul Gottes“. Weil die Sehnsucht nach Gott in ihm so lebendig war, stand er auch dem Nächsten, den Bedürfnissen der Menschen seiner Zeit, so nahe. Als „Mönchspapst“ nannte sich Gregor „Servus servorum Dei“, „Diener der Diener Gottes“, einer der päpstlichen Titel bis heute. Auch wenn der gregorianische Choral nicht direkt auf ihn zurückgeht, so hat doch Papst Gregor mit seinen Bemühungen, etwa auch um die Messe, die Grundlagen für eine liturgische Vertiefung und Erneuerung geschaffen. Die zahlreichen Schriften des Papstes wurden jahrhundertelang gern gelesen, etwa die vier Bücher der Dialoge über das Leben und die Wundertaten der italischen Heiligen. Hier finden sich auch Angaben zum Leben und Wirken des Vaters des abendländischen Mönchtums, des hl. Benedikt. Bekannt sind auch des Papstes umfangreiche Kommentare zu den biblischen Büchern Hiob und Ezechiel.